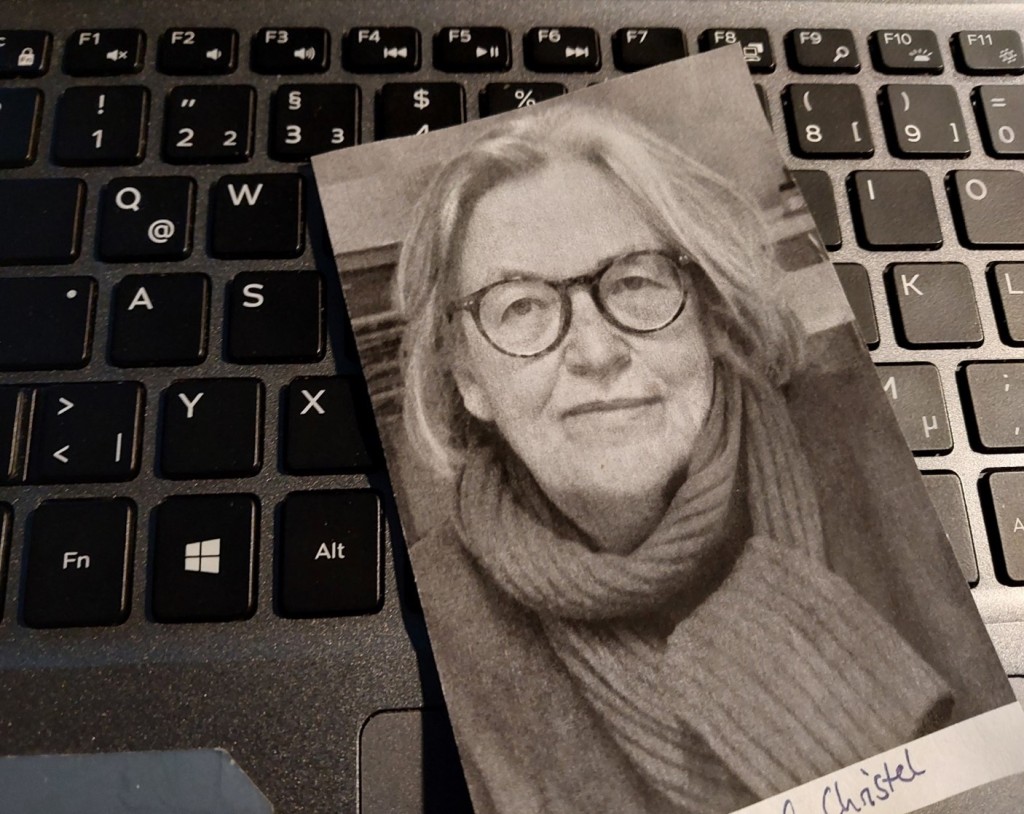Sie hatte Glück: mehr als 800 Seiten ungelesen fanden sich auf ihrem hastig gegriffenen E-Book auf der Intensivstation. „Bitternis“ hat die polnische Schriftstellerin Joanna Bator ihren Roman überschrieben, der fast hundert Jahre Familiengeschichte aus der Sicht der Frauen schildert. Es wird viel geschlachtet, gebraten, verwurstet, der Vater lehrt Berta den Umgang mit dem Fleisch und will sie mit einem Schlachter verheiraten. Doch sie liebt einen anderen, wird schwanger, begeht später mit dem Messer ein Verbrechen. (Ein solcher Vatermord habe sich im 19.Jahrhundert ereignet, hatte die Autorin erfahren.) Es riecht nach Blut, Alkohol, Schweiß, Dreck. Alle stecken fest, selbst als der bleierne Kommunismus dem „Wind of Change“ weicht und die Enkelin, die als erste studieren kann, schafft sie es nicht, ihre Träume auch nur ansatzweise zu verwirklichen. Das alles in Niederschlesien jenseits der deutschen Grenze – und doch so fern, dass hierzulande kaum jemand darum weiß- oder wissen möchte. Feministin Bator selbst ist Vegetarierin, Tierliebhaberin, PiS-Kritikerin und Philosophin, hat in London, Tokio und New York gelebt, schreibt jetzt in einem Vorort von Warschau.
Der sterile Raum auf der Intensivstation und später das Isolierzimmer wegen Covid machen es ihr leicht, sich mit den Frauen durch die beengten Räume, die vergebliche Suche nach einer anderen, besseren Zukunft zu bewegen. Nicht an der Bitternis zu ersticken. Und sich erinnern an die eigene Reise entlang der polnischen Ostseeküste im Juni vorbei an blühenden Hecken und Rapsfeldern, deren Duft sich mit dem aus einer Waffelbude mischte.


Ganz schön rätselhaft diese Buch-Umschläge: Warum scheint der Papageienkopf kopfüber so zufrieden? Und warum blickt einen die junge Frau lächelnd an hinter den Buchstaben eines solchen Titels?
Wenig mehr als 200 Seiten braucht Sigrid Nunez, um mit „Die Verletzlichen“ zurück in die Corona-Zeit zu führen. Mitten in ein New York, das jeder, der konnte, verlassen hat. Die namenlose Ich-Erzählerin landet in einer Art Wohngemeinschaft mit einem ihr unbekannten jungen Mann und dem Auftrag, sich um den zurückgelassenen Papagei „Eureka“ mit eigenem Zimmer zu kümmern. Lesend lässt sich der Erzählerin folgen, wenn sie sich erinnert an ihr Jugend-Vorbild Jane Godall oder die Hippiezeit. Es gibt zufällige Begegnungen, ein vergessenes Notizbuch auf einer Parkbank, die Schreibblockade und der Verlust des Selbstvertrauens. Ängste und Träume von Trump. Zu erfahren ist auch mehr über den Mythos der Büchse der Pandora., wobei sich in Corona-Zeiten die Frage stellt: Warum blieb die Hoffnung in der Büchse, als die Übel entwichen? Wozu noch langfristige Pläne, fragt sich die Ich-Erzählerin, offenbar auf der Suche nach einer neuen Form des Schreibens. Sie muss erleben, wie der junge Mann namens Giersch mit Eureka „aus meinem Leben, aus meinem Roman“ geht. Während sie zurückkehrt in ihre alte Wohnung und das Dasein als Schriftstellerin. CB
Sigrid Nunez „die Verletzlichen“, Übersetzt von Anette Grube. Aufbau Verlag, 224 Seiten, 22 €
Joanna Bator „Bitternis“. Aus dem Polnischen von Lisa Palmes. Suhrkamp Verlag, 829 Seiten, 23 €