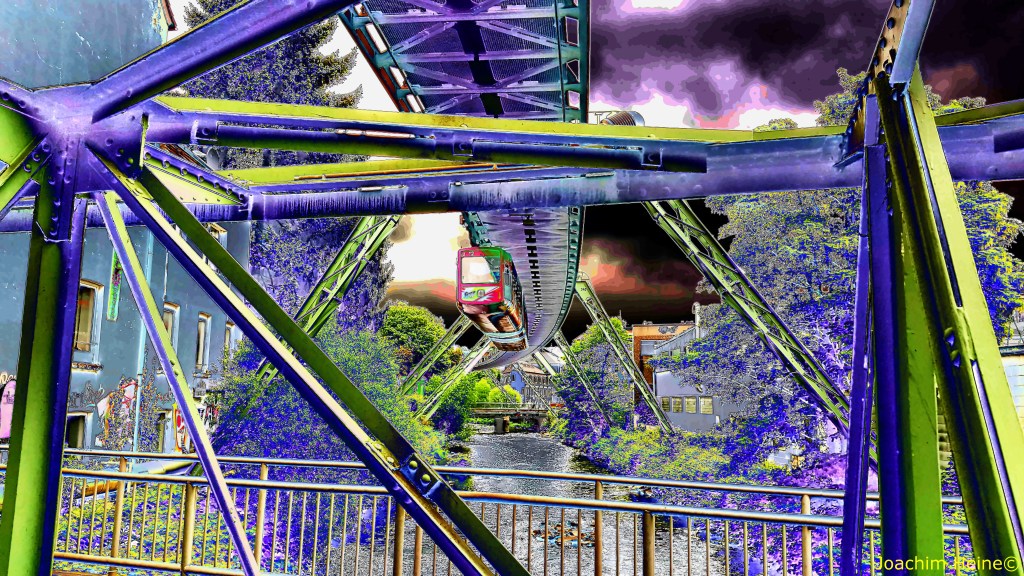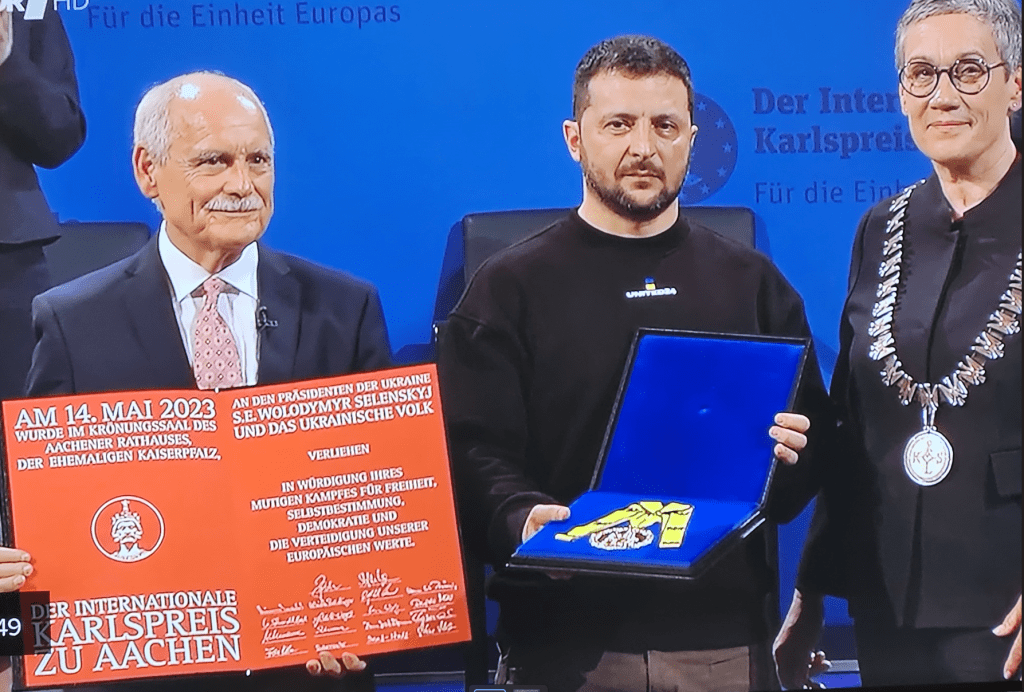Wer über die Hohenzollern-Brücke Richtung Dom geht, begegnet nicht nur immer eiligen älteren E-Bike-Fahrern sondern auch staunenden Touristen, die Fotos machen von den „Liebes“-Schlössern am Zaun zu den Gleisen. Wer hat diese Tradition begründet? Warum wird als Ausdruck überschwänglicher Gefühle ausgerechnet ein Schloss gewählt und Namen wie Daten vermerkt, um es dann abzuschließen und Schlüssel in den Rhein zu werfen? Um Sehnsucht und Suche für alle Zeiten für beendet zu erklären, allen Erfahrungen zum Trotz? Was für ein Kontrast zu Luftballons oder Tauben (beides bedenklich), die in himmlische Weiten entlassen werden oder Herzen, die in Baumrinden wachsen können. So manches Schloss rostet, stammen die „N“ von einem oder mehreren? Und bedeutet „R.I.P. Amy“ etwa ein ungewolltes tragisches Ende?

Am Rand der Hohe Straße mit immer mehr Candy-Stores statt „feiner“ Mode hat sich eine Musikgruppe aus Osteuropa niedergelassen. Zwei Saxofone, Akkordeon, Gitarre, Bass und Rhythmus. Die ersten Töne des Songs kleben mich am Pflaster fest und lassen mich zurücksinken ins Jahr 1985. „I just call to say I love you“ von Stevie Wonder. Heimlich verliebt war ich, mit ihm gemeinsam zu diesem Hit zu tanzen war magische Nähe. „Just“ anzurufen immer einen Versuch wert vor der Zeit der Handys. Eine elegante alte Dame neben mir scheint auch in anderen Welten oder ihr Innerstes versunken zu sein. Ein Paar hat die Koffer abgestellt und folgt wippend dem Rhythmus. Eine sehr farbig gekleidete junge Asiatin tanzt vor den Musikern mit dem Handy in der Hand. Entsteht gerade das Selfie einer Influencerin? Ihrem Publikum zuwinkend schwebt sie weiter, während die Straßenband „Volare“ intoniert.

Auf dem Weg zum Neumarkt quere ich an einer Ampel die Nord-Süd-Fahrt, eine Schnellstraße mit hohem Stau-Potenzial, die seit 1962 historisch gewachsene Stadtviertel zerschneidet. Darüber spannen sich auch Gebäude – auf einem Dach war von 2005 bis 2021 ein roter Schriftzug zu sehen: „Liebe deine Stadt“ – 4 Meter hoch und 26 Meter breit. Was für eine Ansage ausgerechnet über dieser als „autofreundlich“ gedachten Schneise. Dem 1974 in Graz geborene und in Köln lebenden Konzeptkünstler Merlin Bauer geht es mit solchen Arbeiten darum, Architektur als soziale Aufgabe zu verstehen und Gestaltungsspielräume zu nutzen. „Wir wollen, dass es unseren Kindern und Nachbarn gutgeht“, sagte er dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Das Projekt soll ein Aufruf und zugleich der Aufbruch zu einer Stadt-Debatte sein. Was kann jeder Einzelne von uns tun, um diese Welt um uns herum positiv zu gestalten“.
Fünf Minuten weiter: zwischen Geschäftshäusern in der Nähe des Neumarkts eine Szene der besonderen Art. Ein großer Herz-Luftballon, riesige Blumensträuße, bunt bemalte Plakate, Handys, ein kleines Kind, eine ältere Frau mit Kopftuch, rund zehn bestens gelaunte junge Frauen, einige Männer. Mit Lachen und Freude unterlegte deutsche, englische und andere fremdsprachige Wortfetzen. Ich erfahre, eine von ihnen hat die letzte Prüfung des Zahnmedizin-Studiums bestanden. Das sei fast noch wichtiger als Hochzeit, flüstert mir eine der jungen Frauen zu.

„An einem Ort überlagern und verweben sich heute vielfältige kulturelle Orientierungen und Erbschaften“, lese ich zuhause im Begleitmaterial zu einer Ausstellung, in der auch der große Schriftzug zu sehen ist. „Kultur ist nicht einheitlich, sondern vielstimmig, ein Zusammentreffen vieler kollektiver Gedächtnisse und Erinnerungsgemeinschaften.“ Schön formuliert, denn da passt alles hinein. Der Song „Liebe deine Stadt“ ebenso wie das Tattoo mancher FC-Fans oder Postkarten und Taschen mit dem roten Schriftzug. Und die Szenen eines Spaziergangs. CB
Sehenswert das „official Video“ zum Song „Liebe Deine Stadt“, weil es nicht nur Mo Torres, Cat Ballou und Lukas Podolski präsentiert, sondern auch die Architektur und Vielfalt in Köln.
Die Webseite www.liebedeinestadt.de mit vielen Informationen über die Konzeptkunst von Merlin Bauer, Interviews und Berichte über Aktionen und die aktuelle Ausstellung im KOLUMBA Museum Köln bis 14.August 2023.