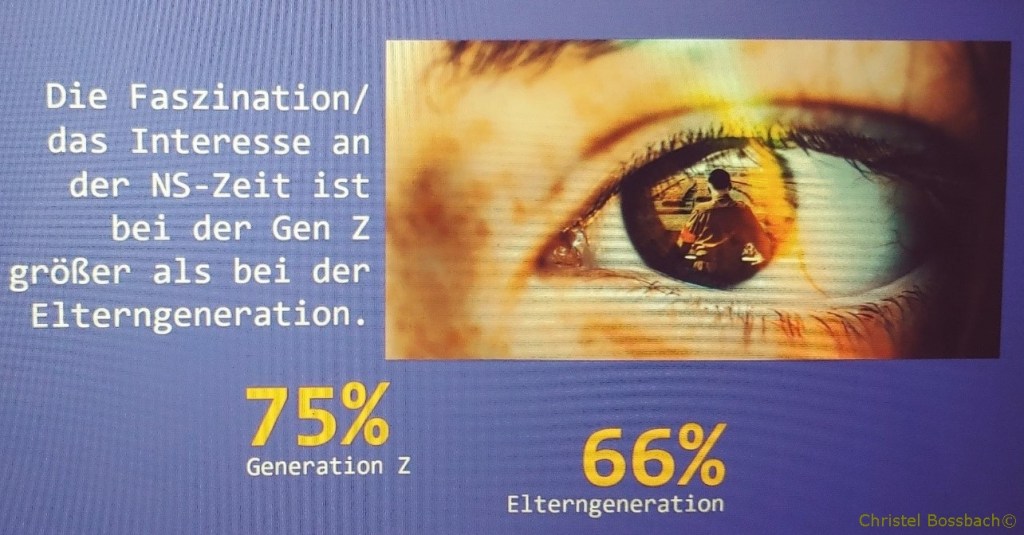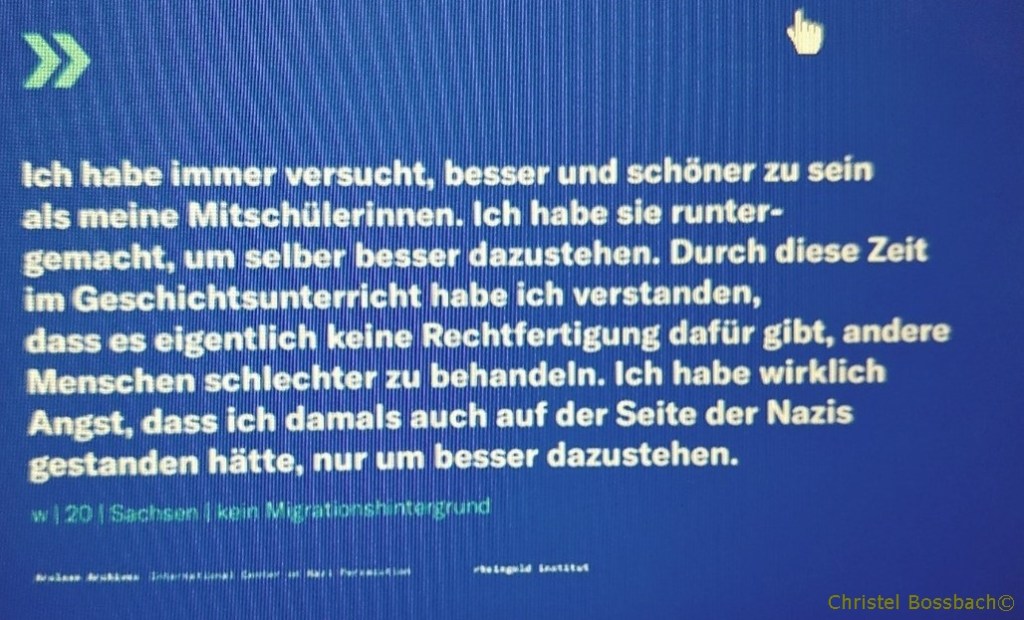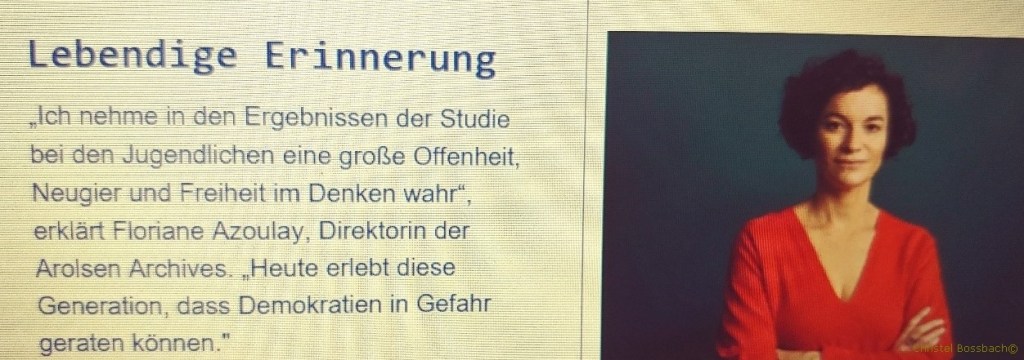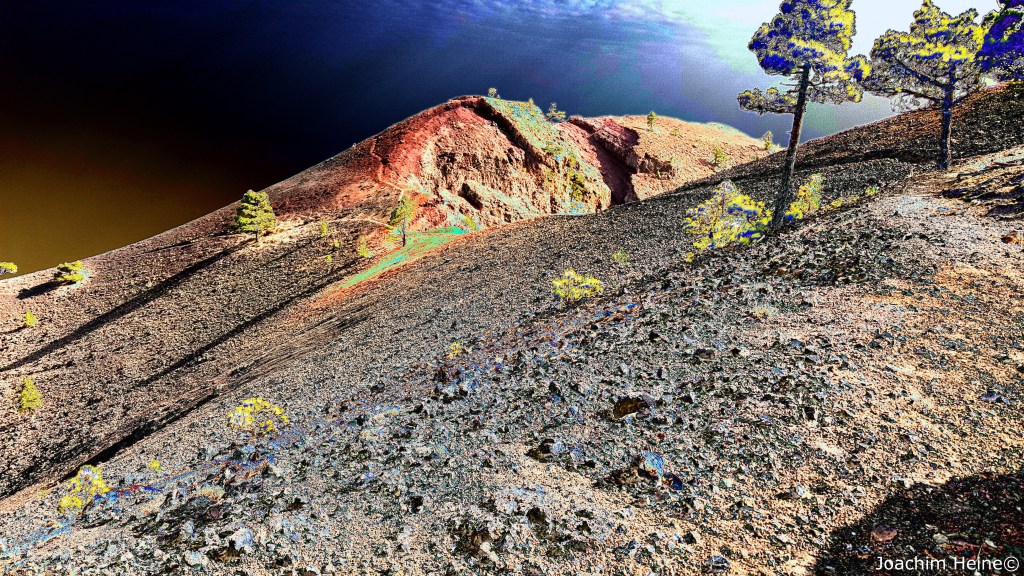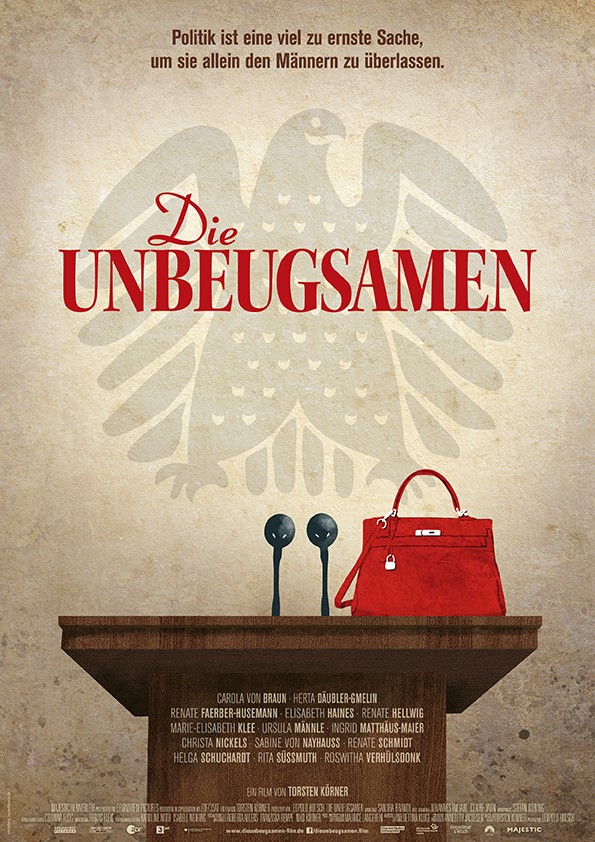Seit einigen Wochen geht mir manches, das ich gelesen habe, nicht aus dem Kopf oder taucht auf, wenn das Gender*sternchen Kapriolen schlägt in gesprochenen oder gedruckten Texten. Oder ich höre klassische Musik und stelle mir bildhaft das Orchester vor – wieviele darin sind nicht männlich, wie viele haben welche Hautfarbe…wann war das noch mal, dass die erste Frau Mitglied der Berliner Philharmoniker wurde?
Wie gut, dass es die Mediatheken gibt und diese erstaunte Freude noch bis zum 4.5. bei 3Sat abgerufen werden kann. „7 Leben für die Musik- die Familie Kanneh-Mason“, eine Dokumentation von Catharina Kleber führt mitten hinein in ein Haus in Nottingham, das summt und hallt von Tasten- und Streicherklängen der fünf Schwestern und zwei Brüder. Ob nun im Bad geprobt oder per Zuruf verhandelt wird, wann es Zeit zum gemeinsamen Essen ist. Die Eltern Kadiatu und Stuart mit Wurzeln in Jamaika und Sierra Leone wurden vom Talent und dem Ehrgeiz ihrer Kinder überrascht. Der Vater, ein Hotelmanager, und die Mutter, die als Englisch-Dozentin an der Hochschule gearbeitet hatte, sorgten sich um die Kosten für Instrumente und Unterricht. Längst gibt es Preise, Stipendien und Auftritte, auch gemeinsame der sieben.Die Mutter hat ein Buch über die Familie verfasst – im Film ist zu sehen, wie einige der Kinder mit Instrumenten unterwegs sind, um eine Lesung musikalisch zu begleiten. Oder wie die Rollen verteilt sind – der geigende Bruder als Konzertmeister- bei Aufnahmen im Tonstudio. Übrigens mag der Cellist Sheku dem einen oder der anderen bekannt vorkommen. 2016 hatte er den „BBC Young Musician Competition“ gwonnen und spielte während der Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle. Schnee von gestern, in Corona-Zeiten fachsimpelt er mit Dirigent Sir Simon Rattle bei Orchester-Aufnahmen in einem Flugzeug-Hangar.
Wunderbar, so viele musikalische Geschwister – und doch eine normale Familie. Ist es für schwarze Musker*innen wirklich schwerer, sich in der Klassik-Szene zu etablieren, wie ein Programmhinweis fragt? Wahr ist, sie fallen auf, werden zu Repräsentanten in der derzeitigen „black live matters“-Epoche und können nicht so einfach in der Menge „untertauchen“ oder sich eingebettet fühlen in die wohlwollende Akzeptanz farbiger Jazzmusiker*innen oder Hiphopper*innen oder Reggae-Stars.

Ganz schön kompliziert: „Afro-britisch“
„Was Rassismus betrifft, wird es hoffentlich einmal wissenschaftliche Essays über den Umgang dieses Romans mit ihm geben“, schreibt taz-Rezensent Dirk Knipphals. „Er ist für die Figuren so massiv vorhanden wie die Schwerkraft, geschildert wird er in allen möglichen Ausprägungen von handfester Ausgrenzung bis hin zum Wegrücken im Fahrstuhl.“ Bis diese Essays vorliegen führt uns Bernardine Evaristo in „Mädchen, Frau etc.“ im Roman durch völlig verschiedene schwarze Lebensläufe, die geprägt sind durch die Vernetzung mit anderen und die damit verbundene Unterstützung, Konflikte, Trennungen.
„Afrobritisch“ wird umschrieben, wie heterogen diese durch zeitlich unterschiedliche Einwanderungswellen aus der Karibik oder Afrika entstandene Community ist und wie mühsam und oft über Generationen hinweg Veränderungen erfolgen: wie viel muss vermeintlich „cool“ weggelächelt werden, um als Bankerin Karriere machen. Wie mühsam ist der Weg bis zur Theaterpremiere im Londoner National Theatre. Evaristo, die 1959 in London geboren wurde und als Professorin Creative Writing unterrichtet, hat mit ihrem Roman 2019 den Booker-Preis gewonnen und wird literarisch auch für ihre Sprache gewürdigt. Ohne Punkte enden die Wortketten oft vor dem Ende der Zeile-
Das hat Wirkung
Bernardine Evaristo: „Mädchen, Frau etc.“, 512 S., Tropen Verlag Stuttgart, 25 €

Nicht ohne mein Smartphone
Eine Generation jünger ist die 1989 geborene Candice Carty-Williams, die 2020 für ihren Debütroman „Queenie“ 2020 bei den British Book Awards als erste Schwarze überhaupt die Auszeichnung „Book oft he Year“ erhielt. Verloren zwischen den Kulturen fühlt sich die Titelheldin, die sich notorisch in weiße Männer verliebt und darüber den Job in einer Kulturredaktion vernachlässigt. Zum Lachen ist das oft nicht, wenn Queenie (der Name eine Reminiszenz an die britische Königin) als erste der Familie mit einem College-Abschluss immer tiefer in eine Depression gleitet, erniedrigenden Sex meint ertragen zu müssen und sich dem strengen Regiment der Großeltern unterwirft. Dating Portale haben zusätzlich Verwirrung geschaffen – der Verlauf der kurzen Mitteilungen ist Teil des Romans und die reale Konfrontation mit den übergriffigen Männern und ihren Erwartungen an schwarze Frauen. Zum Glück gibt es aber auch die Freundinnen und ihre Chat-Bemühungen, die Zuversicht zu verbreiten versuchen. „Traurig und verwirrt“ sei sie nach der Preisverleihung gewesen, wird Carty-Williams zitiert, gerade weil diese Premiere – aus erste Schwarze ausgezeichnet! – so überfällig gewesen sei. Nach Lektüre ihres Buches könnten weiße Leser hoffentlich besser verstehen, was sie meine. Und weiße Leserinnen auch, kann ich da nur ergänzen. CB
Candice Carty-Williams: „Queenie“ Roman, 544 S., Blumenbar Verlag