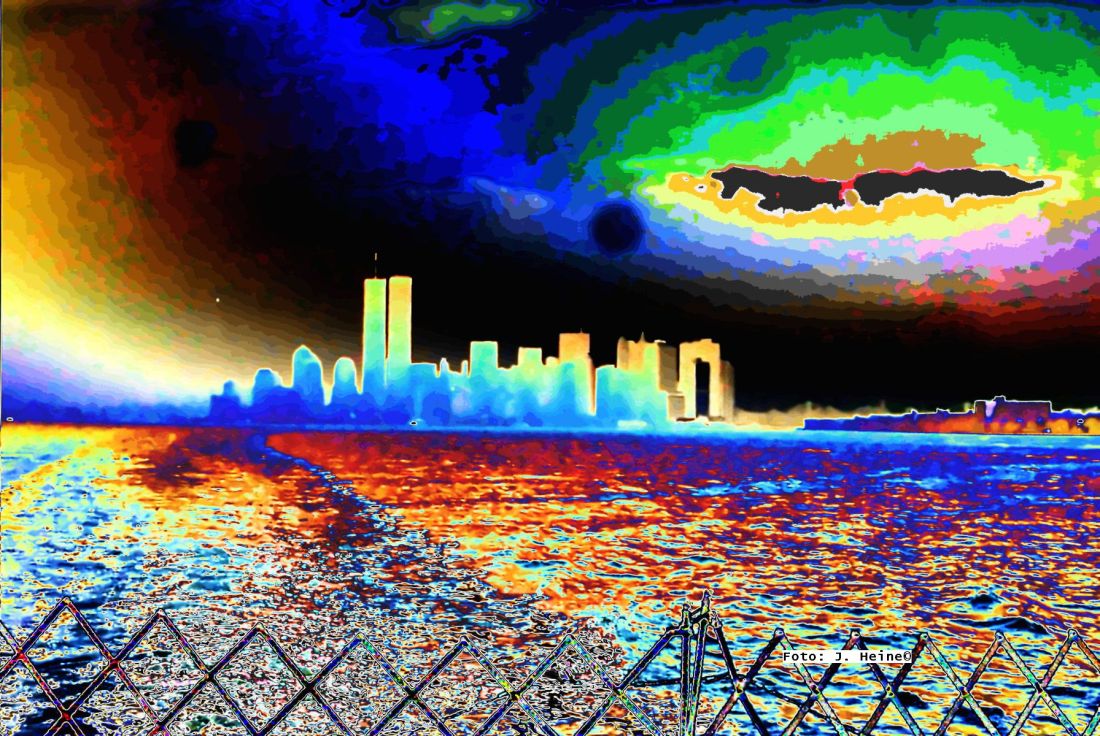„Wir brauchen mehr resiliente Beschäftigte.“ Diese Aussage eines Chefs hat mich vor einiger Zeit auf die Palme gebracht. Es klang nach unbesiegbaren Heldinnen und Helden in schimmernder Rüstung, die nichts, aber auch gar nichts aus der Fassung bringen kann. Weder Überstunden noch wachsende Berge von Aufgaben. Als beherrschten sie Fachliches ebenso wie Personalführung und brauchten keine zusätzliche Qualifizierung. Im Internet werden inzwischen „Resilienz-Trainings“ für Führungskräfte angeboten, um „systemelastisch“ Teams in stürmischen Zeiten zu den gesetzten Zielen zu führen. Und Resilienz-Coaching lässt sich auch da und dort erlernen. „Kinder stark machen“ ist längst Thema nicht nur einer Reihe von Erziehungsratgebern, sondern auch Programm in Kitas.
Der Begriff Resilienz hat Karriere gemacht. Das englische „resilience“ bedeutet übersetzt Elastizität, Spannkraft und Unverwüstlichkeit. In der Psychologie wird mit Resilienz die Fähigkeit umschrieben, belastende Lebenssituationen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu bestehen. Als Vorbild wird in vielen Veröffentlichungen auf Pippi Langstrumpf verwiesen. Der Seeräuber-Vater der Halbwaisen meldet sich nur sehr sporadisch und muss eher von ihr unterstützt werden. Sie selbst lebt allein in einem großen Haus, muss sich um Pferd und Affen kümmern, kann nicht lesen, schreiben oder rechnen. Und doch schließt sie neue Freundschaften und stellt sich mit Spaß neuen Herausforderungen, die sie kreativ, schlau, mutig und bärenstark zu meistern versteht. Die pure Lebensfreude!
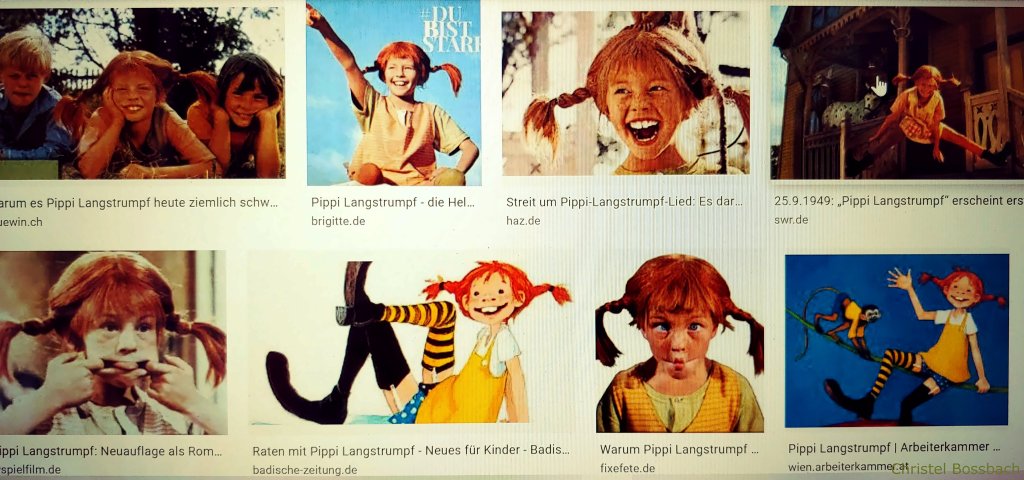
2013 wurde das Sachbuch der Wissenschaftsautorin Christina Berndt mit dem Titel „Resilienz- das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft“ zum Bestseller. Vor allem die Ausgangsfrage der ersten Langzeit-Studien aus den 1950er Jahren hat mich fasziniert: warum gelingt es manchen Kindern beruflich und sozial erfolgreich zu sein, „etwas aus sich zu machen“ trotz schwieriger Herkunftssituation, Gewalterfahrungen, Armut, Flucht, Krankheit oder dem Tod naher Angehöriger? „Das Hervorragende des Resilienz-Blickwinkels besteht darin, auch in belasteten, krisenhaften Lebensläufen vorhandene Kompetenzen und Fähigkeiten zu beleuchten statt Defizite und Pathologie, auf die Frage einzugehen, was gesund hält statt auf die Entstehung von Krankheit“, betonte die Diplompsychologin Barbara Schickentanz, bei einer Fachtagung 2008 in Neuwied. So können Menschen, die ein Kind liebevoll unterstützen, eine schwierige Beziehung zur Mutter oder gar deren Abwesenheit kompensieren helfen. „Kinder stark machen“ ist längst Thema nicht nur einer Reihe von Erziehungsratgebern, sondern auch Programm in Kitas.

Christina Berndt schildert in ihrem Buch verständlich, wie Erkenntnisse der Forschung über das Umfeld eines Menschen, aus Neurobiologie und Genetik dazu beitragen können, das „Geheimnis“ der Resilienz zu lüften. Und sie zieht Lehren für den Alltag daraus. So wie es erleichternd sein kann, den Blick auf die Kompetenzen und Fähigkeiten zu fokussieren, so ermutigend ist es auch, dass zwar Kinder in den ersten zehn Lebensjahren am besten „Bewältigungspotenzial“ aufbauen. Doch auch Erwachsene könnten ihre Widerstandsfähigkeit noch schulen, meint etwa der Kinder- und Jugendpsychologe Georg Kormann und rät, sich einen resilienten Menschen zum Vorbild zu nehmen. Den, so Kormann, könne man mit einem Boxer vergleichen, „der im Ring zu Boden geht, angezählt wird, aufsteht und danach seine Taktik grundlegend ändert.“
Ob sich der erwähnte Chef so seine resilienten Mitarbeiter vorstellt oder ob er nur erwartet, dass sie stur weitermachen und nicht jammern? „7 Wege zur Resilienz“ listet Barbara Schickentanz auf: Soziale Kontakte aufbauen, Krisen als Herausforderung sehen, realistische Ziele entwickeln, von der Opferrolle zur Aktivität, Selbstvertrauen aufbauen, Perspektiven entwickeln und Selbstfürsorge. Und sie fasst ihre Erkenntnisse noch kürzer zusammen:
„Suche dir einen Freund und sei anderen ein Freund
Fühle dich für dein Verhalten verantwortlich
Glaube an dich selbst“
Pippi Langstrumpf hätte nicht so wohlgesetzte Worte gefunden. Aber die „Sachensucherin“ wäre auf ihrem „Kleinen Onkel“ mit den Freunden Tommy und Annika neuen Abenteuern entgegengeritten: chaotisch, aber immer freundlich, fürsorglich gegenüber Schwächeren und voller Streitlust gegenüber Erwachsenen. Dieses Vorbild hatte der Chef sicher nicht vor Augen auf der Suche nach resilienten Beschäftigten. Während die Psychologin Schickentanz über Pippi meint: „Eins können wir jedenfalls hier schon einmal lernen: Resiliente Kinder sind nicht immer die einfachsten Gesprächspartner.“ CB
Weiter lesenswert: Christina Berndt „Resilienz Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft“, dtv premium. Mit einigen Selbsttests.
Die Äußerungen von B. Schickentanz stammen aus dem Auswertungsreader einer Fachtagung über Resilienz, veranstaltet 2008 vom „Runden Tisch Rhein-Westerwald“