Unvermittelt das Lied im Autoradio: „When I’m 64“ gehörte zum Repertoire meiner Schwester und mir. Sie konnte Gitarre spielen, und wir verfügten seit Sprachferien nahe London über das das „Beatles-Songbook“. Wie auf Knopfdruck kann ich Pop-, Folk- und andere „Oldies“ mitsingen, nicht nur von den „Pilzköpfen“. (Ein Freund schrieb neulich, er könne 30 Gedichte auswendig, die ihm viel bedeuteten. Respekt!)
Jetzt bin ich schon einen Monat selbst 64. Es war nichts als die Idee einer Eintagsfliege, den Geburtstag mit einer „magical mystery“ Party zu feiern. Aber zurück zum Song: ich habe keine Haare verloren – wohl eher ein Problem mancher Männer- und habe nicht selbst gefragt: „Will you still need me, will you still feed me/ when I’m 64?“ Auf Hilfe angewiesen war ich schon mit 50 für einige Wochen nach dem Bruch des Sprunggelenks. „You’ve got a friend“ – darauf kann ich mich bisher mit Carole King verlassen, wenn es mal eng wird.
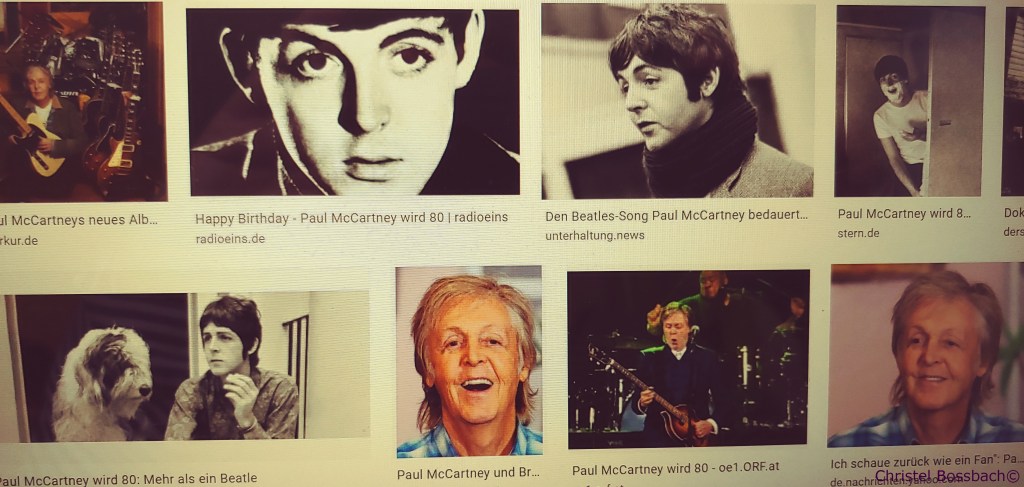
Die „New York Times“ hat sich über die Fragen, die Paul-McCartney im Song stellte, Gedanken gemacht, als der Beatle 64 wurde. Das war 2006. Als Teenager aus Liverpool hatte er ironisch gefragt, ob er denn „many years from now“ weiter mit Liebe, Treue, Familie und Fürsorge auch für den Garten sowie selbstgestrickten Pullovern rechnen könne. Wie es heißt, schrieb er den Text für seinen Vater. In Pauls Geburtsjahr 1942 betrug in Großbritannien die durchschnittliche Lebenserwartung eines Jungen 63 Jahren. Erschreckend aus heutiger Sicht. Die im letzten Monat veröffentlichte Berechnung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden kommt für heute 60-jährige Frauen auf durchschnittlich mehr als 25 weitere Jahre und für Männern noch 21 Jahre.
Paul McCartney kann dieses Jahr seinen 80. feiern, steht weiter auf der Bühne und scheint Bob Dylans Wunsch „Forever Young“ nachzueifern. Prominent, reich und doch, so Beatles-Biograph Bruce Spizer, hätte er wohl gerne mit seiner 1998 verstorbenen Frau Linda länger das Glück der kleinen Dinge wie die Gartenarbeit geteilt.

Vor Jahren schon bescheinigte US-Starautorin Gail Sheehy den 64-Jährigen einen „360 Grad- Rundum-Blick auf das Leben“. Sie könnten an gestern glauben und nicht aufhören über morgen nachzudenken. Was mein Gedächtnis einen weiteren Beatles-Song abrufen lässt: „Yesterday“, als der Ärger noch so weit weg war. Ukraine-Krieg, Klimawandel, soziale Verwerfungen, private Konflikte… stimmt nicht, Probleme und überhaupt Veränderung gab es immer als Begleitmusik des Lebens.
Ich verheddere mich dabei, die ganzen Statistiken und Prognosen in Relation zum eigenen Leben zu setzen. So viel lässt sich dadurch nicht erfassen; die Routinen vom Aufwachen bis zum Einschlafen, überraschende Begegnungen, Ärger und kleine Glücksmomenten wie das Geschenk von Tomaten beim Vorbeigehen an Schrebergärten. Köstlich! „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen muss es nicht um gloriose Sporterfolge und ausverkaufte Konzertsäle gehen. Wie Campino – immerhin auch schon 60 – im ZDF über das Altwerden sagte: Die Dinge zu würdigen, die einem widerfahren sind, werde leichter. Ein tröstlicher Satz. Nach einer anspruchsvollen Wanderung gestern im Bergischen Land kann ich noch eins draufsetzen: der letzte Anstieg vorbei an Apfelbäumen voller Früchte, dann die Tische des Bauern-Lokals auf einer Wiese. In der Luft schweben Töne und Worte einer Sängerin, die nur mit ihrer Gitarre Leonard Cohens „Halleluja“ intoniert. Das sind Tage, das Leben zu feiern. CB




















